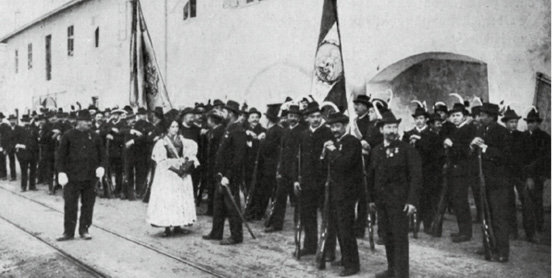KVW Aktuell
Gottes- und Nächstenliebe
 Josef Stricker
Josef Stricker
Das Neue Testament hat die Gottes- und Nächstenliebe eng zusammengerückt. Jesus wird gefragt, welches das größte, das wichtigste Gebot sei, gewissermaßen der Schlüssel zum Ganzen. Er antwortet auf diese Frage aller Fragen mit dem Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinemganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten.“
Gottesliebe führt zur Nächstenliebe – jedenfalls dann, wenn Gott so gedacht wird wie ihn Jesus verkündet hat, wie ein Vater der nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hält und seinen ältesten Sohn, der voll Zorn über so viel Güte des Vaters die Teilnahme am Fest zunächst verweigert, auch noch umstimmen kann.
Von Nächstenliebe ist schon im Alten Testament die Rede. Der Nächste im Alten Bund ist ein Mitglied des Gottesvolkes. Jesus leugnet das nicht. Aber er weitetden Begriff des Nächsten auf alle Menschen aus. Der barmherzige Samariter ist dafür ein vorzügliches Beispiel. Als Samaritaner gehört er nicht zum jüdischen Volk, trotzdem hilft er dem, der unter die Räuber gefallen ist - ein für den Samariter im wahrsten Sinn des Wortes ganz fremder Mensch - und macht sich damit selbst zu dessen Nächsten.
Jesus versteht Nächstenliebe viel radikaler; er dehnt sie sogar auf die Feinde aus. Bei Lukas heißt es: „Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und teilen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdetSöhne und Töchter des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.“ Der Nächste kann unsympathisch, ja abweisend sein. Das ist, sagt Jesus, kein Grund, ihn links liegen zu lassen.
TEXT: Josef Stricker
„Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinemganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten.“
Gottesliebe führt zur Nächstenliebe – jedenfalls dann, wenn Gott so gedacht wird wie ihn Jesus verkündet hat, wie ein Vater der nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hält und seinen ältesten Sohn, der voll Zorn über so viel Güte des Vaters die Teilnahme am Fest zunächst verweigert, auch noch umstimmen kann.
Von Nächstenliebe ist schon im Alten Testament die Rede. Der Nächste im Alten Bund ist ein Mitglied des Gottesvolkes. Jesus leugnet das nicht. Aber er weitetden Begriff des Nächsten auf alle Menschen aus. Der barmherzige Samariter ist dafür ein vorzügliches Beispiel. Als Samaritaner gehört er nicht zum jüdischen Volk, trotzdem hilft er dem, der unter die Räuber gefallen ist - ein für den Samariter im wahrsten Sinn des Wortes ganz fremder Mensch - und macht sich damit selbst zu dessen Nächsten.
Jesus versteht Nächstenliebe viel radikaler; er dehnt sie sogar auf die Feinde aus. Bei Lukas heißt es: „Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und teilen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdetSöhne und Töchter des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.“ Der Nächste kann unsympathisch, ja abweisend sein. Das ist, sagt Jesus, kein Grund, ihn links liegen zu lassen.
TEXT: Josef Stricker